Nikon Coolpix 8400 Kurzbericht
Hier stelle ich eine frühe Digitalkamera von Nikon vor; auch Ralf Jannke hat die Coolpix 8400 bereits hier gewürdigt. Boris hat sie hier beschrieben. Sie war eine der beiden ersten Kompaktkameras von Nikon, die einen iTTL-kompatiblen Blitzschuh für die damals neuen Blitzgeräte SB-800/SB-600 hatte.
Spezifikationen
- Die 2004 vorgestellte Nikon Coolpix 8400 ist 113 x 82 x 72 mm groß und wiegt ohne Batterien und Speicherkarte 400 g.
- Der 2/3“ CCD-Sensor (8,8 x 6,6 mm) löst maximal 3264 x 2448 Pixel = 8 Megapixel auf, der Pixelpitch beträgt 2,7µm. Die Empfindlichkeit ist automatisch oder manuell von 50 bis 400 ASA einstellbar. Bilder werden als JPEG, TIFF oder NEF (RAW) auf CompactFlash-Karten Typ I oder II (max. 32 GB) gespeichert. Videos sind mit 640x480 Pixeln bei 30 Bildern/s möglich.
- Das Objektiv ist ein 6,1-21,6mm/1:2,6-4,9 3,5-fach Zoom mit 10 Elementen in 7 Gruppen, davon 2 ED-Elemente, die kb-äquivalente Brennweite beträgt 24-85 mm.
- Das Motiv wird über einen 1,8“ TFT LCD Monitor mit 134.000 Subpixeln angezeigt, zusätzlich ist ein Videosucher 0,44“ mit 235.000 Subpixeln eingebaut. Außerdem ist ein beleuchtbares Status-LCD-Schulterdisplay mit etlichen Belichtungsparametern vorhanden.
- Entfernungseinstellung Einzel-Autofokus (AF-S) oder AF-Nachführung (AF-C), hybride Ermittlung durch aktiven IR-AF-Sensor und Kontrasterkennung des Bildsensors, 9 AF-Felder automatisch oder manuell auswählbar
- Belichtungssteuerung durch Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik oder manuellen Modus, 256-Zonen-Matrixmessung, mittenbetont integrale oder Spotbelichtungsmessung. Belichtungszeiten 8s bis 1/8000 sek. (kombinierter mechanischer und elektronischer Verschluss), elektronischer Selbstauslöser mit 10 s Vorlaufzeit
- elektrisch ausklappbarer Blitz mit Leitzahl 14 bei ISO 100, zusätzlich Norm-Blitzschuh mit iTTL-Zusatzkontakten
- Weißabgleich automatisch oder manuell
- ohne Bildstabilisierung
- Energieversorgung durch Lithiumakku EN-EL7
Besonderheiten
„Coolpix“ heißen bei Nikon fast alle alle Kompakt- bzw. Bridge-Digitalkameras.
Die Kamera ist eine „echte“ Nikon „Made in Japan“ und keine OEM-Auftragsfertigung. Sie wurde kurz vor der photoKina 2004 zusammen mit der teilweise baugleichen Coolpix 8800 vorgestellt, diese hat ein Zoomobjektiv mit anderem Brennweitenbereich, der weit in den Telebereich reicht, jedoch weniger Weitwinkel hat.
Die Stromversorgung erfolgt nicht mehr wie bei den Vorgängern mit fast überall erhältlichen Mignon-Zellen. Statt dessen setzte Nikon erstmals den Lithium-Akku EN-EL7 ein, der nur in wenigen anderen Nikon-Kameras eingesetzt wurde und heutzutage nur zu Preisen Größenordnung 100 (!) Euro angeboten wird. Preiswerte Nachbauten existieren nicht, jedoch gibt es Anbieter, die die Zellen des Original-Akkus durch neue ersetzen.
Es gab einen Batteriegriff/Hochformatauslöser mit zweiter Zoomwippe für 6 Mignonzellen MB-CP10, dieser ist aber genauso wie das originale Netzteil EH-54 nur sehr selten zu bekommen und deshalb erheblich teurer als die Kamera.
Zur Bildaufzeichnung dienen CompactFlash-Karten Typ I, die dickeren Karten des Typ II passen ebenfalls. Im Lieferumfang war keine Karte enthalten, Karten bis 32GB funktionieren, obwohl solch große Karten zum Herstellzeitpunkt der Kamera nur spezifiziert, aber erst etliche Jahre später verfügbar waren.
Die Karte ist durch eine Klappe geschützt.
Gespeichert können sowohl unkomprimierte RAWs (NEFs), TIFFs als auch JPEGs in verschiedenen Kompressionsstufen und Auflösungen. Ein unkomprimiertes TIFF ist etwa 24 MB groß, seine Speicherung dauert entsprechend lange. Ein NEF hat 12 MB und wird deshalb in der halben Zeit „weggeschrieben“.
Das Display ist recht klein. Die Auflösung mit 134.000 Subpixeln ist aus heutiger Sicht grobgerastert, damals wurde es als brauchbar bezeichnet. Das Display kann ausgeklappt und gedreht sowie geschwenkt werden. Zum Schutz kann es um 180° gedreht werden, so daß seine Rückseite nach Außen zeigt.
Zusätzlich zum Display gibt es einen Videosucher mit Dioptrienkorrektur, der eine höhere Auflösung hat, aber ebenfalls mit heutigen Suchern nicht mithalten kann. Das Sucher-LCD-Panel ist höchstwahrscheinlich von Epson zugekauft worden und wurde baugleich in etlichen Kameras der Mitbewerber verbaut, z. B. in der Sony DSC-F828, der Olympus C-8080 oder der Canon PowerShot Pro1.
Die Bedienung ist allerdings noch lange nicht so bequem wie mit heutigen Kameras, vieles wird per Menu eingestellt. Die wichtigsten Funktionen wie Aufnahmemodus, Belichtungskorrektur, Fokus, Bildgröße sowie -Qualität, Empfindlichkeit oder Blitzparameter können durch Druck auf eine Taste oder Drehen des Modusrades und gleichzeitigem Drehen des Daumenrades verstellt werden. Der Hauptschalter ist um den Auslöser herum angebracht. Gezoomt wird mit einer Daumenwippe. Zur Bildwiedergabe muß das Moduswahlrad gedreht werden, eine Taste vor die schnelle Bildwiedergabe der letzten Aufnahme gibt es nicht.
Das Menu ist umfangreich, die Kamera kann recht fein auf den Fotografen angepaßt werden, viele Parameter werden auch nach Akkuwechsel gespeichert. Ist das Display umgedreht, also nicht sichtbar, ist die gesamte Kamerasteuerung auch mittels des Videosuchers möglich, allerdings muß man dann die Position der Tasten kennen.
Der 8-Megapixel-Sensor Sensor wurde von Sony hergestellt und auch in etlichen anderen Kameras verbaut, darunter z. B. die Coolpix 8700.
Der Gehäuseblitz ist fest eingebaut, er klappt nach Betätigen eines Tasters elektrisch betätigt recht weit nach oben aus dem Gehäuse heraus. Die Blitzbelichtungsmessung erfolgt durch das Objektiv mittels Vorblitzen. Erstmals in einer Nikon Kompaktkamera ist ein iTTL-kompatibler Blitzschuh eingebaut, die zusammen mit der D2 bzw. D70 vorgestellten Aufsteckblitze SB-600/SB-800 können von der Kamera gesteuert werden und ergeben eine ausgewogene Belichtung, die sowohl das Umgebungslicht als auch das Blitzlicht gut dosieren, „totgeblitze“ Motive gibt es fast nicht. Der Zoomreflektor des Aufsteckblitzes paßt sich der Kamerabrennweite an, im rückseitigen Display des Blitzes stehen etliche Aufnahmeparameter.
Allerdings ist die Bedienung des internen und des externen Blitzes etwas unbeholfen umgesetzt:
Will der Fotograf das Motiv aufhellen, obwohl die Kamera meint, daß dies nicht nötig sei, so muß der interne Blitz erst abgeschaltet werden, dann der Aufsteckblitz eingeschaltet und dessen Blitzmodus auf „Erzwungen“ umgestellt werden. Wird der erste Bedienschritt vergessen, klappt sofort der Kamerablitz aus und will zusammen mit dem Aufsteckblitz auslösen. Nach Anfertigen der Aufnahme und Abschalten des Aufsteckblitzes steht der interne Blitz automatisch wieder auf „Erzwungen“ und muß wieder in „Automatisch“ umgeschaltet werden. Beim nächsten Motiv, das aufgehellt werden soll, beginnt die gesamte Prozedur erneut.
Es wäre einfacher gewesen, die Firmwareprogrammierer hätten die von vielen anderen Kameras her bekannte Bedienweise übernommen, bei der ein externer eingeschalteter Blitz automatisch immer mitblitzt, schließlich hat der Fotograf ihn ja extra eingeschaltet, um die Szene auszuleuchten.
Im Lieferumfang ist die Infrarot-Fernbedienung enthalten, die bei anderen Nikon-Kameras extra für 30 Euro erworben werden mußte.
Das Objektiv beginnt bei damals erstmals in eine Kompaktkamera eingebaute Weitwinkel-Brennweite von 24mm und reicht nur in den leichten Telebereich von 85 mm. Es gab Konverter, die den Brennweitenbereich entweder in den Weitwinkel- oder in den Telebereich erweiterten. Zwischen den beiden Brennweiten-Enden gibt es insgesamt 18 Zwischenstufen, so daß durchaus fein dosiert gezoomt werden kann, allerdings ist dieser Vorgang mit der Zoomwippe prinzipbedingt umständlicher als mit einem mechanischen Zoomring. Dieser hatte aber keinen Platz gefunden, der das Objektiv umgebende geriffelte Ring ist ein fest angebautes Zierelement.
Die Streulichtblende mußte extra erworben werden, sie gehörte nicht zum Lieferumfang der Kamera. Das Filtergewinde beträgt 37mm und dreht sich weder beim Zoomen noch beim Scharfstellen mit. Meine gezeigte Lösung ist nicht original, sondern ich verwendete einen Adapterring 37-49mm und eine 49mm-Weitwinkelblende.
Der Objektivdeckel ist vom Snap-On-Typ, wird er beim Einschalten vergessen, passiert nicht schlimmes, da er zusammen mit dem Objektiv ausfährt. Die originale Tragekordel wird wie üblich am Kameragurt befestigt, somit baumelt der Deckel beim Fotografieren herum, kann jedoch nicht verloren werden.
Der Autofokus arbeitet hybrid: neben der üblichen Kontrastermittlung durch den Bildsensor gibt es die von den filmbasierten Kompaktkameras her bekannte aktive Infrarottechnik: Eine IR-Diode sendet einen Strahl auf das Motiv, die Laufzeit bis zum Eintreffen des reflektierten Licht in der daneben angeordneten IR-Empfangsdiode wird gemessen, daraus kann die Motiventfernung errechnet werden. Da mit der aktiven Messung vorfokussiert wird, erfolgt die anschließende Fokussierung auf dem Bildsensor schneller als bei Kameras, die nur mit Kontrasterkennung arbeiten.
Über dem aktiven-AF-Sensor ist eine helle LED als AF-Hilfslicht eingebaut, leider kann sie im Menu nicht abgeschaltet werden.
Die Kamera schreibt einige spezielle Angaben in den MakerNotes-Teil der EXIFs, darunter etliche Bildparameter wie ASA-Automatik, montierter Konverter, AF-Steuerung, die art der Fukusermittliung (aktiv/passiv/hybrid) uvm. In den genormten Feldern der EXIFs trägt die Coolpix 840 die „wahren“ Belichtungswerte ein, nicht die üblichen gerundeten Zahlen. z. B. Blende 6,1 und Belichtungszeit 1/335 Sekunde statt 1:5,6 und 1/500 Sekunde. Die Zahl der Auslösungen kann nur der Service ermitteln, sie steht nicht in jedem aufgenommenen Bild.
Als Schnittstellen stehen zur Verfügung: Video, Netzteil und USB zum Auslesen der Bilder aus der Kamera bzw. zum Anschluß eines Druckers. Video und USB sind zu einer Nikon-eigenen Spezialbuchse zusammengefaßt, Normkabel passen deshalb nicht. Die Buchse zur Stromversorgung ist seitlich angebracht und ebenfalls wie die anderen Schnittstellen mit einer unverlierbaren Gummiabdeckung geschützt, auch sie erfordert ein Spezialkabel.
Der Werbeaufkleber wurde vom Vorbesitzer nicht abgezogen, Nikon wies auf Folgendes hin: 24mm-Weitwinkel-Objektiv, Videos mit 30 Bildern pro Sekunde, Makrofunktion mit 3 cm Abstand ab Vorderlinse, schneller hybrider Autofokus.
Der UVP der Coolpix 8400 betrug 1000 Euro. Ich erwarb mein Exemplar 2022 für 55 Euro inkl. OVP, Anleitung und fast allem Zubehör. Der Vorbesitzer hatte es 2006 als Ersatzkamera für 400 Euro im Ausverkauf erworben und kaum benutzt, fast alle Gebrauchsspuren stammen von mir. Der Akku ist noch durchaus brauchbar, er schafft bei Verzicht auf den internen Blitz durchaus 150 bis 200 Aufnahmen.
Alle Aufnahmen entstanden bei 50 ASA, gespeichert als RAW, konvertiert mit Nikon Capture NX, bearbeitet mit Photoshop CS6. Die Größe wurde auf 1500 Pixel bikubisch verkleinert. Schärfe, Verzeichnung, Vignettierung, Gradationskurve usw. wurden korrigiert. 100%-Aussschnitte sowie die Aufnahmeparametern finden sich in jedem Bildbeispiel.
Qualitäts- und sonstiger Eindruck
Das Gehäuse der Coolpix 8400 ist größtenteils aus Metall gefertigt, der Entwurf stammt vom Stardesigner Giugiaro, der auch viele Nikon-Spiegelreflexkameras seit der F3 gestaltet hat oder auch viele Automobile wie z. B. den 1974er VW-Golf. Die rechte Gurtöse ist ungünstig angebracht, sie befindet sich unter dem Auslöse-Zeigefinger und stört dort. Das Kamera-Gehäuse besteht aus einer leichten und trotzdem stabilen Magnesiumlegierung.
Die Kamera gehört zur Klasse der Kompaktkameraskameras für den ambitionierten Amateur, die als Prosumer-Kameras bezeichnet wurden. Ihre Leistung (Auflösung, Bedienbarkeit, Einschaltzeit, Bildspeicherdauer usw.) bewegte sich im damals durchaus üblichen Rahmen. Die Einschaltzeit hingegen ist überraschend lang: erst fährt das Zoomobjektiv aus, dann „bootet“ die Kamera noch etwa eine Sekunde, bevor sie aufnahmebereit ist.
Die Bildqualität ist aufgrund der Sensorgröße und des recht großen Pixelpitchs zum Vorstellungszeitpunkt als gut zu bezeichnen gewesen, jedoch ist die Auflösung des Objektivs im Telebereich und in der Weitwinkelstellung geringer als in der Normalstellung. Außerdem verzeichnet es bei 24mm deutlich sichtbar, eine Korrektur dieses Bildfehlers durch den Bildprozessor findet nicht statt.
Bei höheren ASA-Zahlen verlieren die JPEGs der Kamera durch den Entrausch-Algorithmus deutlich an Zeichnung, sind aber noch recht erträglich.
Fazit: eine digitalkamerahistorisch interessante Kamera, heutzutage zum ernsthaften Bildermachen aufgrund der exotischen Stromversorgung eher nicht mehr geeignet.
Christian Zahn
Neuen Kommentar schreiben
| Autor: | Christian Zahn |
| Mail senden | |
| Erstellt: | 29.01.2023 |














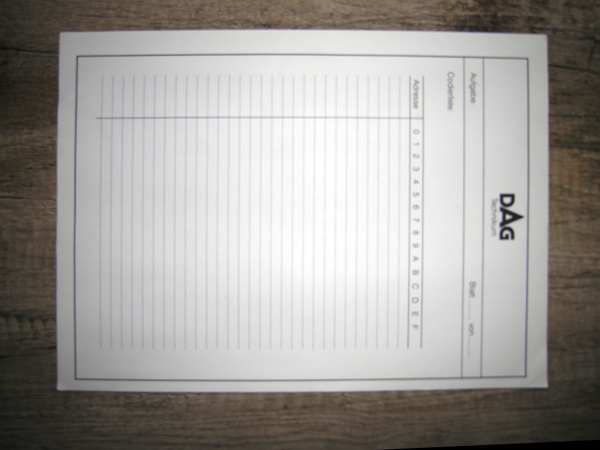

Kommentare (0)
Keine Kommentare gefunden!