Sony DSC-F55E Kurzbericht
Die Sony DSC-F55E haben Ralf Jannke und Boris Jakubasch bereits vorgestellt
Praxisbericht 1 Praxisbericht 2
Das Hybrid-Display der Kamera finden beide zu dunkel und kaum benutzbar.
Spezifikationen
- Die 1999 vorgestellte Sony DSC-F55E ist 103 x 79 x 48 mm groß und wiegt 250 g.
- Der 1/2“ (6,4x4,8mm) CCD-Sensor mit Pixelpitch 3,8µm löst maximal 1600 x 1236 Pixel = 2 Megapixel auf (Rohdaten 2,1 Megapixel). 100 ASA feste Empfindlichkeit. MPEG-Videos sind mit 320x240 Pixeln möglich (max 1 Minute Länge). Bilder werden als JPEG oder auf MemoryStick (max. ca. 256 MB) gespeichert.
- Das Motiv wird über einen 2“ Hybrid-TFT LCD Monitor mit 123.000 Subpixeln (559x220 Farbtripel) angezeigt, der auch die Menüsteuerung übernimmt.
- Das Objektiv ist eine 1:2,8/6,85mm (37 mm @KB) Carl Zeiss Distagon Festbrennweite
- Entfernungseinstellung Einzel-Autofokus (AF-S), Ermittlung durch Kontrasterkennung des Bildsensors
- Belichtungssteuerung durch Vollautomatik, mittenbetont integrale Belichtungsmessung. Belichtungszeiten 1/25s bis 1/1000 sek., Selbstauslöser mit 10 s Vorlaufzeit
- eingebauter Blitz mit ca. Leitzahl 8
- Weißabgleich automatisch
- keine Bildstabilisierung
- Energieversorgung durch Lithium-Akku
Besonderheiten
DSC bedeutet Digital Still Camera. Neben der DSC-F55E gab es auch eine Version ohne „E“, der technische Unterschied ist vermutlich marginal, auch in der Bedienungsanleitung findet sich kein Hinweis darauf. „CyberShot“ hießen die meisten Sony-Digitalkameras, bei der F55E wird es merkwürdigerweise mit Binnen-Bindestrich als „Cyber-shot“ geschrieben.
Die F55E ist vermutlich die erste Sony-Kamera mit einem von Carl Zeiss gerechnetem Objektiv und dem damals neuem Speicherkartentyp MemoryStick.
„Distagon“ war ein Name für Weitwinkelobjektive, die Carl Zeiss seit 1953 herstellte, das verbaute Objektiv soll von Zeiss in Deutschland gerechnet worden sein, hergestellt wurde es wie die restliche Kamera in Japan. Die Streulichtblende ist fest eingebaut, der spezielle rechteckige Objektivdeckel ist mit einer kurzen Schnur am Trageriemen befestigt.
Der Sensor stammt vermutlich aus der Videotechnik, er nimmt nacheinander zwei Halbbilder auf, die per Interlacing zu einem Gesamtbild zusammengesetzt werden. Schnell bewegte Motive werden darum bei längeren Belichtungszeiten etwas „verwischt und gestreift“ aufgenommen.
Das Design ist gewöhnungsbedürftig, im Jahre 1999 war das allgemein übliche Digital-Kompaktkamera-Design noch nicht herausgebildet, die Hersteller experimentierten mit vielen Arten von Bauformen. Sony entschied sich ähnlich wie andere Hersteller für eine drehbar gelagerte Objektiv/Sensor/Blitz-Einheit, sie kann um 180° nach hinten gedreht werden. Ab einem gewissen Winkel wird das Bild dabei automatisch gedreht, so daß auch „Selfie“-Aufnahmen mit nach hinten gerichtetem Objektiv richtig herum angezeigt und aufgenommen werden.
Die Stromversorgung erfolgt mit dem bei Sony in einigen anderen Kameras bzw. Camcordern eingesetzten Lithium-Akku NP-F10. Wie bei Sony üblich ist es ein „InfoLithium“-Typ, es ist ein kleiner Chip im Akku eingebaut, der die Restkapazität minutengenau an die Kamera übermittelt. Keine dreistufige und ungenaue Akkurestanzeige wie bei vielen anderen Kameras. Der Chip verhinderte auch für einige Zeit, daß preiswerte Akku-Nachbauten benutzt werden konnten.
Der Hauptschalter ist ähnlich wie bei Sony-Camcordern ein Schieber mit einem Entriegelungsknopf, aus Versehen bzw. in der Fototasche schaltet sich die F55E niemals ein. Das Bedienkonzept ist ebenfalls etwas ungewöhnlich, das Steuerkreuz mit Testfunktion sitzt z. B. links an der Rückseite, der Umschalter zwischen Bild, Video und Wiedergabe an der rechten Kameraschmalseite.
Akkufach und Speicherkartenfach sind getrennt, benutzt wird erstmals in einer Sony-Digitalkamera der damals neue MemoryStick. Diese nur von Sony eingesetzten Flash-Speicherkarten waren teurer, langsamer und mit geringerer Kapazität als die damals weit verbreiteten CompactFlash-Karten. Immerhin lieferte Sony einen (mit 8MB allerdings recht kleinen) Stick mit, größere mußten extra dazugekauft werden. Die später auf dem Markt gebrachte SD-Karte verdrängte den MemoryStick, ab etwa 2010 beugte sich Sony der Marktmacht und verzichtete auf sein eigenes Kartenformat.
Der Gehäuseblitz ist eingebaut und wird zusammen mit dem Objektiv gedreht. Die Blitzbelichtungsmessung erfolgt nicht mittels Vorblitz, sondern durch eine „klassische“ eigene Meßzelle neben dem Objektiv.
Die Hintergrundbeleuchtung des Displays ist zu Stromsparzwecken abschaltbar, dann erkennt man allerdings fast überhaupt nichts mehr, wie zeitgenössische Kameratests bereits anmerkten. Auch mit eingeschalteter Beleuchtung ist bei heller Sonne nicht mehr viel zu sehen. Möglicherweise war das früher besser, bei meinem Exemplar ist das Display sichtbar gealtert, es glänzt auch nicht überall gleichmäßig. Die 123.000 Subpixel sind aus heutiger Sicht nur grob geraster, damals wurde es als hochauflösend bezeichnet.
Die maximal 320x240 Pixel „großen“ und 1 Minute langen Videos werden erstmals in einer Sony-Kamera als MPEG1-Video codiert, nicht wie damals üblich als AppleQuickTime oder Microsoft/Intel AVI-Video.
In die EXIF-Daten jedes Bildes schreibt die Kamera nur sehr wenige Informationen, weder Blende, Brennweite, Belichtungszeit, ASA-Wert usw. werden eingetragen, als Name steht einfach „Sony Cybershot“ in den Daten, nicht die genaue Modellbezeichnung.
Videobuchse und serielle Schnittstelle sind übliche Klinkenbuchsen. Zur dauerhaften Stromversorgung ist ein Akkudummy erforderlich.
Die UVP der F55E betrug ca. 2000 DM, das entspricht etwa 1000 Euro. Ich bekam mein Exemplar im Frühjahr 2021 vom Betreiber dieses Online-Museum geschenkt. Aus heutiger Sicht erscheint die Kamera teuer, damals war der Preis für die gebotene Leitung durchaus angemessen. Zum Vergleich: die ebenfalls 1999 vorgestellte Nikon F100, eine Profispiegelreflexkamera für Kleinbildfilm, kostete 2600 DM.
Alle Aufnahmen entstanden bei 100 ASA, gespeichert als JPEG, bearbeitet mit Photoshop CS4. Die Bilder wurden auf 1500 Pixel zugeschnitten, es sind somit 100%-Ansichten. Gradation, Schärfe, Farben usw. wurden nicht korrigiert, es sind also „PICs out of the Cam“. Da die Kamera keine Belichtungsparameter in die Bilder schreibt, konnte ich diese nicht „eintexten“.
Die Verzeichnung des Objektivs wird nicht weggerechnet, ist allerdings nicht besonders ausgeprägt.
Qualitäts- und sonstiger Eindruck
Das Gehäuse der F505V besteht größtenteils aus Metall (aufgrund des Gewichts aber nur aus dünnem Aluminium-Blech), nur einige Anbauteile und Bedienelemente sind aus Kunststoff.
Die Kamera gehört zur Klasse der „Drehgelenk-Kameras“, sie stammt aus einer Zeit, als die Designer noch „spielen“ durften; es gab damals sehr viele ungewöhnlich aussehende Kameras.
Die Bildqualität ist heutzutage nicht als wirklich gut zu bezeichnen, 2 Megapixel sind recht wenig Auflösung, helle Motivdetails neigen schnell zum „Ausbrennen“. In den Himmelspartien ist trotz 100 ASA ein leichtes Farbrauschen erkennbar.
Fazit: eine digitalkamerahistorisch interessante Kamera (weil frühe Drehgelenk-Kamera und ungewöhnliche Bauform der Kamera), heutzutage zum ernsthaften Bildermachen nicht mehr geeignet.
Christian Zahn
Neuen Kommentar schreiben
| Autor: | Christian Zahn |
| Mail senden | |
| Erstellt: | 20.06.2021 |










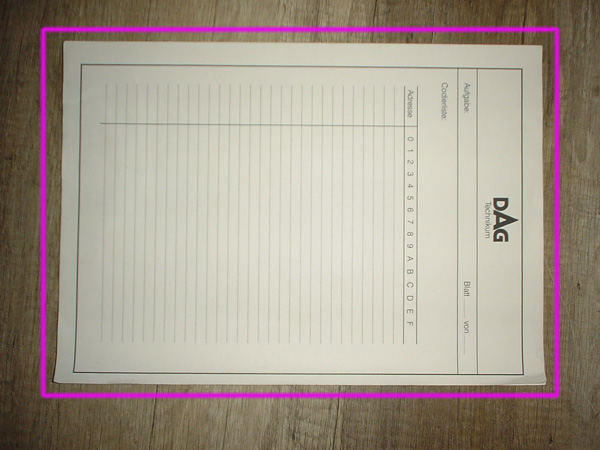
Kommentare (0)
Keine Kommentare gefunden!